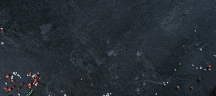Di, 18:23 Uhr
12.06.2018
nnz-Interview
"Früher galt man als Landwirt was!"
Kaum ein anderer Wirtschaftszweig ist derart vom Wetter abhängig wie die Landwirtschaft. Welchen Einfluss das aktuelle Wetter auf die bevorstehende Ernte hat und vieles mehr, das fragte Cornelia Wilhem den Feldbau-Brigadier der Agrargenossenschaft Urbach, Thomas Heise...
 Am Abend ein Feierabendbier mit Freunden (Foto: C. Wilhelm)
Thomas Heise, 3. von rechts
Am Abend ein Feierabendbier mit Freunden (Foto: C. Wilhelm)
Thomas Heise, 3. von rechts
Wie kam Sie zu diesem Beruf?
Thomas Heise: Es war mein Wunschberuf. Ich bin bereits in der zweiten Generation in der Landwirtschaft tätig. Mein Vater führte einst den Vorsitz in einem staatlichen Unternehmen, absolvierte ein Studium zum Agrar-Ingenieur. Wir wurden als Kinder in den Arbeitsalltag mit einbezogen, weil es nicht anders möglich war. Von Kindesbeinen an mussten alle im Garten und Haus mithelfen. Auch in der Schulzeit mussten wir zum Lebensunterhalt der Familie beitragen. Von uns fünf Geschwistern übten später vier den Beruf des Landwirtes aus, nur einer meiner Brüder entschied sich für eine Ausbildung als Koch. Meine Schwester arbeitete in der Tierproduktion, die es zwischenzeitlich auch nicht mehr gibt. Und unsere Mutter verdiente den Lebensunterhalt für die Familie in der Schule.
Wie sehen Sie die Entwicklung der Landwirtschaft im Wandel der Zeit?
Thomas Heise: Der Stellenwert des Landwirtes war früher höher als heute. Man galt als etwas. Die Landwirte aus der Region kannten sich untereinander. Heute ist das Berufsfeld in ein schlechtes Licht gerückt. Ich habe oft den Eindruck, wir sind die Bösen. Viele Leute kennen die Hintergründe in Punkto Pflanzenschutz nicht.
Über die Medien wird das Thema auch teilweise falsch transportiert – ich denke da neben der Pflanzenproduktion insbesondere an das Thema Tierhaltung. Klar, es gibt schon schwarze Schafe. Landwirte, auch in der Pflanzenproduktion, die ihren Job nicht gut machen. Aber gerade die werden in den Medien als Repräsentanten des Berufsbildes vorgestellt. Ob nun Unwissenheit oder Sensationslust eine Rolle spielt, vermag ich nicht zu sagen.
Um nochmal auf das "große Thema Pestizide“ zu kommen: Es ist nicht alles gut, aber wie sollen wir es sonst anders machen? Die Leute sehen oft nur, dass da gerade wieder eine Spritze zum Einsatz kommt. Natürlich gibt es auch „schwarze Schafe“ unter den Landwirten. Aber aufgrund unseres Fachwissens setzen wir die Stoffe nur so knapp wie möglich ein. In Maßen und nach Notwendigkeit.
Alle klagen über fehlendes Fachpersonal? Wie ist das in der Landwirtschaft?
Thomas Heise: Auch bei uns sind die Zahlen rückgängig. Wir bilden derzeit drei Lehrlinge aus. In diesem Jahr werden wir 1600 Hektar mit acht Personen bewirtschaften. Vor 50 Jahren war auf dem Land noch ein Großteil der Menschen in diesem Tätigkeitsfeld beschäftigt. Da waren wir mit 30 Mann auf dem Feld unterwegs.
Welche Faktoren spielen bei diesem Rückgang vorrangig eine Rolle?
Gesellschaftliche Veränderung in der Zeit ab 1989 in erster Linie. Aber auch die zunehmende Industrialisierung. Die Maschinen nehmen einen Teil der Arbeit ab. Aber das macht den Job an sich auch nicht leichter.“ Der Tag während der Bestellung oder der Ernte kann bis zu 16 Stunden umfassen. Die Arbeit umfasst ein halbes Jahr. Die andere Hälfte des Jahres leben wir von staatlichen Transferleistungen. Der Gang zum Arbeitsamt bleibt den meisten von uns nicht erspart. Das macht den Beruf auch für Nachwuchskräfte, nun ja, nicht gerade attraktiv.
Wie kann sich die Landwirtschaft in den kommenden Jahren wieder positiver im Blickpunkt
der Gesellschaft entwickeln?
Thomas Heise: Wir müssen uns bemühen, durch eine sachliche, fachliche und ordentliche Arbeitsweise, gerade auch in Punkto Pflanzenschutz, dazu beizutragen, dass unser Ansehen wieder steigt und die Menschen unsere Arbeit wieder mehr zu schätzen wissen. Dazu zählt natürlich auch ein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln im notwendigen Rahmen. Jedes Mittel bringt nur in angemessener Menge einen Nutzen. Eine übermäßige Anwendung sollte von daher in jedem Fall vermieden werden. Einen Maßstab für ein „Zuviel“ setzt die Geschäftsleitung. Sie legt von oben her fest, wieviel Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden soll. Aufgrund unseres Fachwissens können wir das auch gut in die Praxis umsetzen. Und wir entscheiden
aber auch situationsbedingt.
Viele Landwirte klagen über zu viele Auflagen von staatlicher Seite. Ein Großteil der Verordnungen kommt auch aus dem Europa-Parlament. Was kann die Politik tun, um die Arbeit der Landwirte besser zu unterstützen?
Thomas Heise: Grundsätzlich besteht das Problem, dass in einigen politischen Gremien ganz einfach zu viele Menschen sitzen, die die Arbeit nicht kennen. Die nicht um die komplizierten Vorgänge und die Härte der Landwirtschaft wissen und auch nicht um den Verdienst des Einzelnen. Wenn wir unsere Preise selbst bestimmen dürften, wären wir auch nicht auf staatliche Subventionen angewiesen. Aber das geht ja nicht. Klar soll durch die Subventionen auch die Preisgrenze beeinflusst werden. Stiegen die Preise, gebe es sicher viele Familien, die sich das Essen nicht mehr leisten könnten. Von daher sind die staatlichen Subventionen durchaus begründet.
Und wie wird die Ernte in diesem Jahr?
Thomas Heise: Die Ernte beginnt wahrscheinlich in 14 Tagen. Viel Ertrag erwarte ich mir in diesem Jahr nicht. Und das bei schlechten Preisen. Auf europäischer Ebene wird das sicher niemand interessieren. Aber geerntet werden muss. Wenn die Ernte jetzt beginnen würde, wäre das gut für uns. Jetzt ist der Boden trocken. Aber wenn es zu Erntebeginn regnet, ist das weniger gut. Also hoffen wir, dass die Wetterlage passt, wenn es losgeht.
Vielen Dank für das Gespräch
Autor: red Am Abend ein Feierabendbier mit Freunden (Foto: C. Wilhelm)
Thomas Heise, 3. von rechts
Am Abend ein Feierabendbier mit Freunden (Foto: C. Wilhelm)
Thomas Heise, 3. von rechtsWie kam Sie zu diesem Beruf?
Thomas Heise: Es war mein Wunschberuf. Ich bin bereits in der zweiten Generation in der Landwirtschaft tätig. Mein Vater führte einst den Vorsitz in einem staatlichen Unternehmen, absolvierte ein Studium zum Agrar-Ingenieur. Wir wurden als Kinder in den Arbeitsalltag mit einbezogen, weil es nicht anders möglich war. Von Kindesbeinen an mussten alle im Garten und Haus mithelfen. Auch in der Schulzeit mussten wir zum Lebensunterhalt der Familie beitragen. Von uns fünf Geschwistern übten später vier den Beruf des Landwirtes aus, nur einer meiner Brüder entschied sich für eine Ausbildung als Koch. Meine Schwester arbeitete in der Tierproduktion, die es zwischenzeitlich auch nicht mehr gibt. Und unsere Mutter verdiente den Lebensunterhalt für die Familie in der Schule.
Wie sehen Sie die Entwicklung der Landwirtschaft im Wandel der Zeit?
Thomas Heise: Der Stellenwert des Landwirtes war früher höher als heute. Man galt als etwas. Die Landwirte aus der Region kannten sich untereinander. Heute ist das Berufsfeld in ein schlechtes Licht gerückt. Ich habe oft den Eindruck, wir sind die Bösen. Viele Leute kennen die Hintergründe in Punkto Pflanzenschutz nicht.
Über die Medien wird das Thema auch teilweise falsch transportiert – ich denke da neben der Pflanzenproduktion insbesondere an das Thema Tierhaltung. Klar, es gibt schon schwarze Schafe. Landwirte, auch in der Pflanzenproduktion, die ihren Job nicht gut machen. Aber gerade die werden in den Medien als Repräsentanten des Berufsbildes vorgestellt. Ob nun Unwissenheit oder Sensationslust eine Rolle spielt, vermag ich nicht zu sagen.
Um nochmal auf das "große Thema Pestizide“ zu kommen: Es ist nicht alles gut, aber wie sollen wir es sonst anders machen? Die Leute sehen oft nur, dass da gerade wieder eine Spritze zum Einsatz kommt. Natürlich gibt es auch „schwarze Schafe“ unter den Landwirten. Aber aufgrund unseres Fachwissens setzen wir die Stoffe nur so knapp wie möglich ein. In Maßen und nach Notwendigkeit.
Alle klagen über fehlendes Fachpersonal? Wie ist das in der Landwirtschaft?
Thomas Heise: Auch bei uns sind die Zahlen rückgängig. Wir bilden derzeit drei Lehrlinge aus. In diesem Jahr werden wir 1600 Hektar mit acht Personen bewirtschaften. Vor 50 Jahren war auf dem Land noch ein Großteil der Menschen in diesem Tätigkeitsfeld beschäftigt. Da waren wir mit 30 Mann auf dem Feld unterwegs.
Welche Faktoren spielen bei diesem Rückgang vorrangig eine Rolle?
Gesellschaftliche Veränderung in der Zeit ab 1989 in erster Linie. Aber auch die zunehmende Industrialisierung. Die Maschinen nehmen einen Teil der Arbeit ab. Aber das macht den Job an sich auch nicht leichter.“ Der Tag während der Bestellung oder der Ernte kann bis zu 16 Stunden umfassen. Die Arbeit umfasst ein halbes Jahr. Die andere Hälfte des Jahres leben wir von staatlichen Transferleistungen. Der Gang zum Arbeitsamt bleibt den meisten von uns nicht erspart. Das macht den Beruf auch für Nachwuchskräfte, nun ja, nicht gerade attraktiv.
Wie kann sich die Landwirtschaft in den kommenden Jahren wieder positiver im Blickpunkt
der Gesellschaft entwickeln?
Thomas Heise: Wir müssen uns bemühen, durch eine sachliche, fachliche und ordentliche Arbeitsweise, gerade auch in Punkto Pflanzenschutz, dazu beizutragen, dass unser Ansehen wieder steigt und die Menschen unsere Arbeit wieder mehr zu schätzen wissen. Dazu zählt natürlich auch ein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln im notwendigen Rahmen. Jedes Mittel bringt nur in angemessener Menge einen Nutzen. Eine übermäßige Anwendung sollte von daher in jedem Fall vermieden werden. Einen Maßstab für ein „Zuviel“ setzt die Geschäftsleitung. Sie legt von oben her fest, wieviel Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden soll. Aufgrund unseres Fachwissens können wir das auch gut in die Praxis umsetzen. Und wir entscheiden
aber auch situationsbedingt.
Viele Landwirte klagen über zu viele Auflagen von staatlicher Seite. Ein Großteil der Verordnungen kommt auch aus dem Europa-Parlament. Was kann die Politik tun, um die Arbeit der Landwirte besser zu unterstützen?
Thomas Heise: Grundsätzlich besteht das Problem, dass in einigen politischen Gremien ganz einfach zu viele Menschen sitzen, die die Arbeit nicht kennen. Die nicht um die komplizierten Vorgänge und die Härte der Landwirtschaft wissen und auch nicht um den Verdienst des Einzelnen. Wenn wir unsere Preise selbst bestimmen dürften, wären wir auch nicht auf staatliche Subventionen angewiesen. Aber das geht ja nicht. Klar soll durch die Subventionen auch die Preisgrenze beeinflusst werden. Stiegen die Preise, gebe es sicher viele Familien, die sich das Essen nicht mehr leisten könnten. Von daher sind die staatlichen Subventionen durchaus begründet.
Und wie wird die Ernte in diesem Jahr?
Thomas Heise: Die Ernte beginnt wahrscheinlich in 14 Tagen. Viel Ertrag erwarte ich mir in diesem Jahr nicht. Und das bei schlechten Preisen. Auf europäischer Ebene wird das sicher niemand interessieren. Aber geerntet werden muss. Wenn die Ernte jetzt beginnen würde, wäre das gut für uns. Jetzt ist der Boden trocken. Aber wenn es zu Erntebeginn regnet, ist das weniger gut. Also hoffen wir, dass die Wetterlage passt, wenn es losgeht.
Vielen Dank für das Gespräch