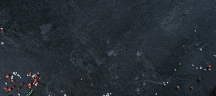Fr, 12:50 Uhr
24.11.2017
Abschlussbericht zum "Werther-Mobil"
Mobilität neu denken
Vier Jahre lang war die Gemeinde Werther mit ihren acht Ortsteilen Testobjekt für die Fachhochschule Erfurt. Im Feldversuch sollte erprobt werden, wie dörfliche Strukturen erhalten werden können. Das "Werther-Mobil" war dabei eigentlich nur eine kleine Ergänzung die zum Hauptaugenmerk wurde. Heute zog man Bilanz...
Ein multifunktionaler Dorfladen der die Gemeindeteile mit dem nötigsten versorgen könnte, das war die ursprüngliche Idee der Erfurter Forscher um Professor Heinrich Kill. Die "Stabilisierung der Nahbereichsversorgung" im ländlichen Raum sollte untersucht werden, so die Vorgabe des Thüringer Ministeriums für Umwelt, Energie und Naturschutz. Anders ausgedrückt: wie schafft man es das die Menschen auch heute auf dem Land noch gut leben können.
Von dem Dorfladen ist nicht viel geblieben, die Landfrauen nutzen das Haus als zentralen Versammlungsort der Gemeinde inzwischen. Geblieben ist hingegen das "Werther Mobil". Das Fahrzeug war eigentlich dazu bestimmt die Waren des Ladens über die verstreuten Teile Werthers zu verteilen. Gleichzeitig sollte die Tauglichkeit von Elektromobilität in ländlichen Gegenden getestet werden. Auch das eigentlich nur wissenschaftlicher Beifang.
Das es ganz anders gekommen ist, das legten die Forscher heute mit vielen Zahlen und Statistiken dar. Statt des Lieferservice erfreute sich der Fahrdienst zunehmender Beliebtheit. In der letzten Projektphase zwischen Januar 2016 und Septmeber 2017 wurden:
Befördert wurden insgesamt 574 Fahrgäste, mit 89% stellten die über 80jährigen dabei die größte Gruppe, gefolgt von den über 60jährigen mit gerade noch 7%. In 59% der Fälle wurde nur ein Fahrgast befördert, immerhin fast ein Viertel der Fahrten wurde von zwei Personen genutzt.
Möglich wurde das alles auch weil man sich in Werther um ehrenamtliche Fahrer bemüht hat. Zwischen acht und zehn Personen sind jede Woche zu unterschiedlichen Zeiten als Fahrer eingeteilt. In Werther ist man sichtlich stolz auf das Engagement der Bürger, viele waren auch zur Präsentation des Zwischenberichtes gekommen.
Und auch die Forschung nahm die Damen und Herren in den Blick. Nach ihrer Motivation gefragt gaben die meisten Ehrenamtler an sich aus Solidarität für ihre Mitmenschen als Fahrer zu engagieren. Viele wollten außerdem speziell den älteren Mitbürgern helfen oder auch soziale Kontakte knüpfen und erhalten.
Auf Seiten der Nutzer konstatieren die Forscher eine große
Dankbarkeit für die Arbeit der Fahrer, eine verbesserte Mobilität sowie ein Gefühl gestiegener Freiheit. Einzelne Nutzer hätten zudem angegeben das der Fahrdienst inzwischen von essentieller Bedeutung für ihren Verbleib am Ort sei.
"Wir haben in vier Jahren richtig was geschafft", sagte Werthers Bürgermeister Hans-Jürgen Weidt. Man habe das Projekt immer auf Basis der aktuellen Erkenntnisse weiterentwickeln können. Zum Elektrofahrzeug kam eine eigene Ladestation, zur Ladestation ein Solarmodul, zur Sonnenenergie ein Speicher der inzwischen auch die Gemeindeverwaltung versorgt und schließlich ein zweites Fahrzeug.
Das wurde vor allem auch deswegen angeschafft weil das erste Auto unter der Woche mit dem Fahrdienst ausgelastet war. Der kleinere Pkw sollte als Leihauto dienen und die Carsharing-Komponente des Projektes abdecken.
Das zweite Fahrzeug wurde in einem knappen Jahr:
Voll des Lobes war denn auch Staatssekretär Olaf Möller. Das sich jeder ein Elektrofahrzeug kauft, das sei nicht der Weg. Man müsse Mobilität heute anders denken. Zentral seien drei Erkenntnisse:
1. man stellt keine Konkurrenz zum öffentlichen Personennahverkehr dar, sonder eine Ergänzung. Das wurde von Seiten der Justiz bestätigt, mehrere Taxiunternehmen hatten gegen das Werther Mobil geklagt und vor Gericht verloren.
2. das Projekt habe gezeigt das Elektromobilität auf dem Land praktikabel sei
3. das sie sich sinnvoll mit regenerativer Enerige vebinden lasse.
"Das ist ein Modell, das funktionieren kann", sagte Möller und in die Breite getragen werden müsse. Dazu haben die Wissenschaftler eine detaillierte Handlungsanleitung verfasst mit der man auch anderswo die Werther'schen Schritte nachvollziehen kann.
Das Projektende soll in Werther derweil nicht das aus für das Werther Mobil sein. Man werde das Modell so lange wie möglich halten, versprach Bürgermeister Weidt, und zeigte sich angesichts der engagierten ehrenamtlichen Fahrer zuversichtlich das dies auch gelingen werde.
Angelo Glashagel
Autor: redEin multifunktionaler Dorfladen der die Gemeindeteile mit dem nötigsten versorgen könnte, das war die ursprüngliche Idee der Erfurter Forscher um Professor Heinrich Kill. Die "Stabilisierung der Nahbereichsversorgung" im ländlichen Raum sollte untersucht werden, so die Vorgabe des Thüringer Ministeriums für Umwelt, Energie und Naturschutz. Anders ausgedrückt: wie schafft man es das die Menschen auch heute auf dem Land noch gut leben können.
Von dem Dorfladen ist nicht viel geblieben, die Landfrauen nutzen das Haus als zentralen Versammlungsort der Gemeinde inzwischen. Geblieben ist hingegen das "Werther Mobil". Das Fahrzeug war eigentlich dazu bestimmt die Waren des Ladens über die verstreuten Teile Werthers zu verteilen. Gleichzeitig sollte die Tauglichkeit von Elektromobilität in ländlichen Gegenden getestet werden. Auch das eigentlich nur wissenschaftlicher Beifang.
Das es ganz anders gekommen ist, das legten die Forscher heute mit vielen Zahlen und Statistiken dar. Statt des Lieferservice erfreute sich der Fahrdienst zunehmender Beliebtheit. In der letzten Projektphase zwischen Januar 2016 und Septmeber 2017 wurden:
- 482 Fahrten durchgeführt
- und rund 15.300 Kilometer zurückgelegt
- davon entfielen bei 360 Fahrten rund 10.000 km auf den Fahrdienst
- das Fahrzeug 74 mal von der Gemeindeverwaltung genutzt, die knapp 2000 km fuhr
- das Auto 48 mal von Privatpersonen oder Vereinen gemietet
- häufigstes Ziel war Nordhausen
Befördert wurden insgesamt 574 Fahrgäste, mit 89% stellten die über 80jährigen dabei die größte Gruppe, gefolgt von den über 60jährigen mit gerade noch 7%. In 59% der Fälle wurde nur ein Fahrgast befördert, immerhin fast ein Viertel der Fahrten wurde von zwei Personen genutzt.
Möglich wurde das alles auch weil man sich in Werther um ehrenamtliche Fahrer bemüht hat. Zwischen acht und zehn Personen sind jede Woche zu unterschiedlichen Zeiten als Fahrer eingeteilt. In Werther ist man sichtlich stolz auf das Engagement der Bürger, viele waren auch zur Präsentation des Zwischenberichtes gekommen.
Und auch die Forschung nahm die Damen und Herren in den Blick. Nach ihrer Motivation gefragt gaben die meisten Ehrenamtler an sich aus Solidarität für ihre Mitmenschen als Fahrer zu engagieren. Viele wollten außerdem speziell den älteren Mitbürgern helfen oder auch soziale Kontakte knüpfen und erhalten.
Auf Seiten der Nutzer konstatieren die Forscher eine große
Dankbarkeit für die Arbeit der Fahrer, eine verbesserte Mobilität sowie ein Gefühl gestiegener Freiheit. Einzelne Nutzer hätten zudem angegeben das der Fahrdienst inzwischen von essentieller Bedeutung für ihren Verbleib am Ort sei.
"Wir haben in vier Jahren richtig was geschafft", sagte Werthers Bürgermeister Hans-Jürgen Weidt. Man habe das Projekt immer auf Basis der aktuellen Erkenntnisse weiterentwickeln können. Zum Elektrofahrzeug kam eine eigene Ladestation, zur Ladestation ein Solarmodul, zur Sonnenenergie ein Speicher der inzwischen auch die Gemeindeverwaltung versorgt und schließlich ein zweites Fahrzeug.
Das wurde vor allem auch deswegen angeschafft weil das erste Auto unter der Woche mit dem Fahrdienst ausgelastet war. Der kleinere Pkw sollte als Leihauto dienen und die Carsharing-Komponente des Projektes abdecken.
Das zweite Fahrzeug wurde in einem knappen Jahr:
- für 255 Fahrten genutzt
- legte 9.992 Kilometer zurück
- wurde zu 71% von der Gemeindeverwaltung
- und zu 24% von Privatpersonen genutzt
- wobei aber mehr als die Hälfte der gefahrenen Kilometer auf die private Nutzung entfiel
Voll des Lobes war denn auch Staatssekretär Olaf Möller. Das sich jeder ein Elektrofahrzeug kauft, das sei nicht der Weg. Man müsse Mobilität heute anders denken. Zentral seien drei Erkenntnisse:
1. man stellt keine Konkurrenz zum öffentlichen Personennahverkehr dar, sonder eine Ergänzung. Das wurde von Seiten der Justiz bestätigt, mehrere Taxiunternehmen hatten gegen das Werther Mobil geklagt und vor Gericht verloren.
2. das Projekt habe gezeigt das Elektromobilität auf dem Land praktikabel sei
3. das sie sich sinnvoll mit regenerativer Enerige vebinden lasse.
"Das ist ein Modell, das funktionieren kann", sagte Möller und in die Breite getragen werden müsse. Dazu haben die Wissenschaftler eine detaillierte Handlungsanleitung verfasst mit der man auch anderswo die Werther'schen Schritte nachvollziehen kann.
Das Projektende soll in Werther derweil nicht das aus für das Werther Mobil sein. Man werde das Modell so lange wie möglich halten, versprach Bürgermeister Weidt, und zeigte sich angesichts der engagierten ehrenamtlichen Fahrer zuversichtlich das dies auch gelingen werde.
Angelo Glashagel