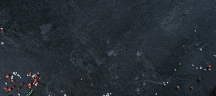Mo, 17:02 Uhr
07.04.2025
Gedenken in Dora
Bei Trauer allein kann man nicht stehen bleiben
Der Befreiung des KZ Mittelbau-Dora vor 80 Jahren gedachte man heute in der Gedenkstätte unter dem Beisein zahlreicher Gäste aus aller Welt. Mit dem Nordhäuser Ehrenbürger Albrecht Weinberg wohnte in diesem Jahr nur noch ein einziger Überlebender dem Gedenken bei…
Am 11. April 1945 war erst die Stadt Nordhausen, dann auch das KZ Mittelbau Dora von amerikanischen Truppen befreit worden. Wenige hundert der einst 60.000 Häftlinge fanden die Alliierten hier noch vor, in den letzten Tagen und Wochen des Krieges hatte man die Lager nahe der Front geleert. Wie viele Menschen auf den Todesmärschen ums Leben kamen, ist bis heute unklar. „Endphase-Verbrechen“ nennen das die Historiker. Doch schon bevor dieser Punkt erreicht war, kostete das Konzentrationslager zu den Füßen der Stadt Nordhausen mindestens 20.000 Menschen das Leben.
Albrecht Weinberg hat die Hölle von Dora überlebt und ist nach dem Ende des Krieges immer wieder nach Nordhausen zurückgekehrt, um dabei zu helfen, dass die Gräuel jener Tage nicht vergessen worden. Im Dezember vergangenen Jahres hat ihn die Stadt Nordhausen für sein jahrzehntelanges Engagement zum Ehrenbürger gemacht, im März feierte er seinen 100. Geburtstag und heute war er der einzige Überlebende, den man zum Gedenken an den 80. Jahrestag der Befreiung noch vor Ort in Nordhausen begrüßen konnte.
Die letzten Zeitzeugen verstummen und nicht immer ist es die Zeit allein, die uns ihre Stimme nimmt. Boris Romantschenko wird im Alter von 16 Jahren zusammen mit seinem Vater aus der Ukraine verschleppt und zur Zwangsarbeit gezwungen. Die Spuren des Vaters verschwinden irgendwo im Untergrund des Ruhrgebietes, der Sohn überlebt. Erst Buchenwald, dann Peenemünde, Dora und schließlich Bergen-Belsen. An seiner statt stand heute seine Enkelin Julia Romantschenko vor den versammelten Gästen aus aller Herren Länder, sprach über den Großvater und sein Schicksal. Nach dem Weltkrieg hat der als Soldat in der sowjetischen Armee gedient, wurde ein gebildeter und angesehener Mann in seiner Heimat, der sich zwar nicht gerne an die Schrecken der Lager erinnert habe, es aber dennoch als seine Pflicht ansah, über das, was er erlebt hat, zu berichten.
Es war nicht das Alter, dass den Holocaust-Überlebenden auf seine letzte Reise führte, sondern eine russische Rakete. Am 18. März 2022, rund einen Monat nach Beginn des großflächigen Angriffskrieges der russischen Föderation auf die Ukraine verbrennt Romantschenko zusammen mit seinem Hund in seinem Haus in Charkiw. Der Enkelin bricht fast die Stimme, als sie vom Anblick der Trümmer berichtet. Ihr eigener Sohn, der Urenkel des einstigen Häftlings, ist inzwischen selber 16 Jahre alt. Ihre Rede schrieb Julia Romantschenko daheim in Charkiw unter dem Donner des russischen Bombardements. Sie schließt mit den Worten: „Wir haben niemanden angegriffen. Wir wollen einen gerechten Frieden und hoffen dass die Menschen wieder zur Vernunft kommen.“
Es wundert wenig, dass die Gedenkstätten davon abgesehen hat, Vertreter des russischen Staates zum Gedenken einzuladen. Dem Gedenken an die Opfer aus Russland und Belarus tue das keinen Abbruch, sagt der Leiter der Gedenkstätte, Andreas Froese. Bei der Trauer allein könne man aber nicht stehen bleiben, Aufgabe sei es auch, das Wissen um die Geschichte dieses Ortes im Detail zu erhalten und zu vermitteln. Wer hat das KZ-System möglich gemacht? Wie hat es funktioniert? Wer war verantwortlich? Wer hat profitiert? Die Auseinandersetzung mit dem dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte gehöre zu den Grundwerten der Gesellschaft. Angriffe auf die Arbeit der Gedenkstätten, Versuche der Umdeutung, die Verleumdung der Geschichte wie es sie auch in Nordhausen und der Region noch geäußert wurden, seien unerträglich.
Zur Kranzniederlegung vor dem Krematorium versammelten sich rund 500 Gäste, noch fünf Stühle hatte man für die Ehrengäste aufgestellt, besetzt wurde nur einer.
Angelo Glashagel
Autor: redAm 11. April 1945 war erst die Stadt Nordhausen, dann auch das KZ Mittelbau Dora von amerikanischen Truppen befreit worden. Wenige hundert der einst 60.000 Häftlinge fanden die Alliierten hier noch vor, in den letzten Tagen und Wochen des Krieges hatte man die Lager nahe der Front geleert. Wie viele Menschen auf den Todesmärschen ums Leben kamen, ist bis heute unklar. „Endphase-Verbrechen“ nennen das die Historiker. Doch schon bevor dieser Punkt erreicht war, kostete das Konzentrationslager zu den Füßen der Stadt Nordhausen mindestens 20.000 Menschen das Leben.
Albrecht Weinberg hat die Hölle von Dora überlebt und ist nach dem Ende des Krieges immer wieder nach Nordhausen zurückgekehrt, um dabei zu helfen, dass die Gräuel jener Tage nicht vergessen worden. Im Dezember vergangenen Jahres hat ihn die Stadt Nordhausen für sein jahrzehntelanges Engagement zum Ehrenbürger gemacht, im März feierte er seinen 100. Geburtstag und heute war er der einzige Überlebende, den man zum Gedenken an den 80. Jahrestag der Befreiung noch vor Ort in Nordhausen begrüßen konnte.
Die letzten Zeitzeugen verstummen und nicht immer ist es die Zeit allein, die uns ihre Stimme nimmt. Boris Romantschenko wird im Alter von 16 Jahren zusammen mit seinem Vater aus der Ukraine verschleppt und zur Zwangsarbeit gezwungen. Die Spuren des Vaters verschwinden irgendwo im Untergrund des Ruhrgebietes, der Sohn überlebt. Erst Buchenwald, dann Peenemünde, Dora und schließlich Bergen-Belsen. An seiner statt stand heute seine Enkelin Julia Romantschenko vor den versammelten Gästen aus aller Herren Länder, sprach über den Großvater und sein Schicksal. Nach dem Weltkrieg hat der als Soldat in der sowjetischen Armee gedient, wurde ein gebildeter und angesehener Mann in seiner Heimat, der sich zwar nicht gerne an die Schrecken der Lager erinnert habe, es aber dennoch als seine Pflicht ansah, über das, was er erlebt hat, zu berichten.
Es war nicht das Alter, dass den Holocaust-Überlebenden auf seine letzte Reise führte, sondern eine russische Rakete. Am 18. März 2022, rund einen Monat nach Beginn des großflächigen Angriffskrieges der russischen Föderation auf die Ukraine verbrennt Romantschenko zusammen mit seinem Hund in seinem Haus in Charkiw. Der Enkelin bricht fast die Stimme, als sie vom Anblick der Trümmer berichtet. Ihr eigener Sohn, der Urenkel des einstigen Häftlings, ist inzwischen selber 16 Jahre alt. Ihre Rede schrieb Julia Romantschenko daheim in Charkiw unter dem Donner des russischen Bombardements. Sie schließt mit den Worten: „Wir haben niemanden angegriffen. Wir wollen einen gerechten Frieden und hoffen dass die Menschen wieder zur Vernunft kommen.“
Es wundert wenig, dass die Gedenkstätten davon abgesehen hat, Vertreter des russischen Staates zum Gedenken einzuladen. Dem Gedenken an die Opfer aus Russland und Belarus tue das keinen Abbruch, sagt der Leiter der Gedenkstätte, Andreas Froese. Bei der Trauer allein könne man aber nicht stehen bleiben, Aufgabe sei es auch, das Wissen um die Geschichte dieses Ortes im Detail zu erhalten und zu vermitteln. Wer hat das KZ-System möglich gemacht? Wie hat es funktioniert? Wer war verantwortlich? Wer hat profitiert? Die Auseinandersetzung mit dem dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte gehöre zu den Grundwerten der Gesellschaft. Angriffe auf die Arbeit der Gedenkstätten, Versuche der Umdeutung, die Verleumdung der Geschichte wie es sie auch in Nordhausen und der Region noch geäußert wurden, seien unerträglich.
Zur Kranzniederlegung vor dem Krematorium versammelten sich rund 500 Gäste, noch fünf Stühle hatte man für die Ehrengäste aufgestellt, besetzt wurde nur einer.
Angelo Glashagel